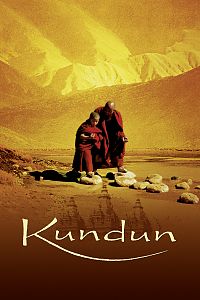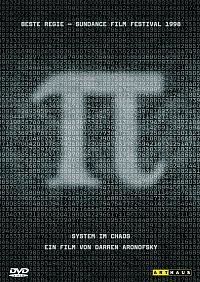Oscars 2020: Verdiente Sieger*innen
Hat es in diesem Jahr die richtigen Filme und Beteiligten getroffen? Ein Rückblick auf die 92. Verleihung der Academy Awards am 9. Februar.
Zahlreiche Filmfans dürften darauf gehofft, ein paar weniger damit gerechnet haben. Der Oscar für den besten Film ging in diesem Jahr erstmals an eine fremdsprachige Produktion. Hätten die bedauernswerten Warren Beatty und Faye Dunaway diese Wahl verkündet, man hätte dem Braten vermutlich nicht so richtig getraut. Aber es war nicht mehr dran zu rütteln, und logischerweise hat Bong Joon-Hos Parasite auch die internationale Auszeichnung errungen, zudem erhielt der Südkoreaner den Award für die beste Regie. Der Thriller mit dem packenden Skript um eine Familie aus bescheidenen Verhältnissen, die sich unerkannt bei den äußerst wohlhabenden Parks einnistet und bald sämtliche Jobs in deren Haus erfüllt, dürfte nicht nur wegen seiner Originalität gewonnen haben. Zum einen hat die Jury die Gelegenheit eines künstlerisch herausragenden Publikumserfolgs genutzt, um sich etwas mehr Diversität zu leisten – nicht die schlechteste Idee. Zum anderen scheint das Thema der sozialen Ungerechtigkeit in Zeiten des blühenden Neoliberalismus selbst in Hollywood mehr Beachtung zu finden als etwa eine tragische Heldengeschichte aus dem Ersten Weltkrieg. Der große Favorit und Golden Globes-Abräumer 1917 ist bei aller formalen Gewagtheit und moralisch wertvollen Erinnerung an barbarische Massaker aber letztlich inhaltlich auch wesentlich konventioneller geraten als Parasite.
In den Krieg hineinversetzt
Das heißt nicht, dass er schlecht wäre. Die zähen Stellungskriege zwischen 1914 und 1918 mit aufgesetzten Bajonetten, erbittertem Luftkrieg, Schützengräben voller Ratten, heimtückischen Gasangriffen und matschigen Schlachtfeldern als Massengräbern – zuletzt kam Peter Jackson dem Ausmaß des Schreckens mit They Shall Not Grow Old schon sehr nahe, indem er historisches Bildmaterial von der Front nachbearbeitete und unter dramaturgischen Gesichtspunkten zusammensetzte. Unmittelbarer als die Schwarzweißbilder der bislang existierenden Dokumentationen wirkte dieser Einblick in das Schicksal der echten Soldaten, wenn auch eine gewisse Distanz durch die Überarbeitungen blieb – wie etwa durch die mit Hilfe von Lippenlesern rekonstruierten Aussagen und Dialoge. Für 1917 setzte Sam Mendes auf ein anderes Spannungsverhältnis zwischen Realität und Fiktion. Ähnlich wie Christopher Nolans WW2-Drama Dunkirk zieht er das Publikum dank inszenatorischem Geschick tief in die Handlung um zwei einfache Soldaten mit einem lebensgefährlichen Spezialauftrag und somit unwiderstehlich in die brutalen Wirren der Kampfhandlungen hinein. Die Figuren sind fühlbar gezwungen, ein Leben zu leben, das von den Gesetzen des Krieges diktiert wird, mit der Aussicht, dass dieses Leben bald vorbei ist, nicht nur für sie selbst. Und das wird beim Zuschauen zur beklemmenden Erfahrung.
Joaquin, Hildur und das wahre Leben
Roger Deakins hat für die spektakuläre Kamera völlig verdient seinen zweiten Oscar erhalten. Die beschriebene Sogwirkung von 1917 ist ja der Illusion einer einzigen Kamerafahrt zu verdanken, in Wahrheit gibt es nur ein paar wenige Schnitte, wie einst bei Hitchcocks Cocktail für eine Leiche. Dabei ist die Produktion technisch aufwändiger als der Filmklassiker, und so überrascht es auch nicht, dass die Oscars für den besten Ton und die besten visuellen Effekte an 1917 gingen. Ein ganz anderes Statement ist sicher Joaquin Phoenix’ Triumph in der Kategorie männliche Hauptrolle – für sein sensibles Method Acting in der ungewöhnlichen Comic-Verfilmung Joker von Todd Phillips. Vielmehr noch als um seine verletzte Männerseele geht es in diesem düsteren Gewaltszenario um die Wurzeln faschistoider Mobilisierung. Obendrauf ist Joker eine ätzende Medienkritik samt klugen Referenzen an Martin Scorseses King Of Comedy – und mit der ebenfalls Oscar-prämierten Filmmusik von Hildur Guðnadóttir letztlich ein ästhetisch faszinierender Trip. Fazit: Nehmen wir den Oscar für American Factory als beste Dokumentation hinzu, die sich mit dem Alltag der Arbeiter einer Fabrik in Ohio auseinandersetzt, haben die realen Verhältnisse auf dem Roten Teppich in diesem Jahr ebenso deutliche Spuren hinterlassen wie im Leben von Hollywood-Star Judy Garland. Und für deren Verkörperung erhielt Renée Zellweger den Award als beste Hauptdarstellerin.
Getoppt wurden diese richtigen und wichtigen Entscheidungen nur von Bong Joon-hos Ankündigung, er werde die ganze Nacht trinken, Billie Eilishs gerümpftem Näschen und von Joaquin Phoenix’ Dankesrede – sowie von Billy Porters extravagantem Kleid, einer Mischung aus Tribute von Panem und afrofuturistischem Glamour – Prêt-à-Billy-Porter eben. Dagegen verblassen selbst die wundervollen und ebenfalls mit einem Oscar bedachten Kostüme aus Greta Gerwigs Little Women, der Adaption jenes Buches, das die beiden Heldinnen von Elena Ferrantes neapolitanischer Saga Meine geniale Freundin in jungen Jahren prägt. Noch so ein Gewinnerfilm 2020, den man gesehen haben sollte, weil man in ihm die gegenwärtigen Verhältnisse der Welt wiedererkennt, die sich außerhalb des Kinosaals befindet. Und das, obwohl er in der Mitte des 19. Jahrhunderts spielt. Die Opulenz der Inszenierung begründete Greta Gerwig wie folgt: Sie habe nicht gewollt, dass sich die Geschichte, auch wenn es darin um das Leben von Frauen gehe, klein anfühle. So macht man großes Kino für alle.
WF