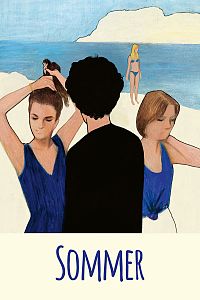Kennen Sie den schon? The Other F Word
Die Dokumentation aus dem Jahr 2011 von Andrea Blaugrund Nevins wirft einen Blick auf Punkrocker, die sich plötzlich in der Vaterrolle wiederfinden. Ein wundervoller Film mit Musikern von Pennywise, NoFX, Bad Religion, Red Hot Chili Peppers, Rancid, Everclear und Blink-182, der auch funktioniert, wenn man mit der Musik nicht so viel am Hut hat.
Fat Mike ist auf der Bühne ein Tier. Der Sänger der bisweilen kultisch verehrten NOFX aus Los Angeles pariert jeden Zwischenruf schlagfertig, kann recht passabel singen, beleidigt sein Publikum auf liebevolle Weise, kann auch größere Moshpits dirigieren und singt herrlich böse, ironische Punksongs wie "Linoleum", "Franco-Unamerican" und "Don’t Call Me White". Seine Band gibt es seit 1983 – und trotzdem ist sie immer noch gern gesehen und gebucht auf den Festivals dieser Welt. Egal ob in Japan, Lateinamerika, Europa oder Australien: Die Chance NOFX im Sommer am späten Nachmittag auf einer mittelgroßen Bühne zu sehen, stehen immer noch gut – wenn nicht gerade eine Pandemie dazwischen kommt.
Fat Mike von NOFX (rechts) hat Frühstück gemacht © STUDIOCANAL GmbH
In The Other F Word gibt es eine Szene, in der Fat Mike seine Tochter weckt. Die damals vierjährige kuschelt sich an seine Hand, sagt: "Daddy, ich bin noch müde." Und fragt dann: "Kannst du mich zu Mommy tragen?" Fat Mike lächelt verlegen in die Kamera, trägt die Kleine ins Schlafzimmer, macht anschließend Frühstück für sie und bringt es ihr auf einem Tablett ans Bett. Dabei lächelt er auf eine Weise, die auch ohne Worte sagt: "Was willste machen?"
Es spricht für Regisseurin Andrea Blaugrund Nevins und ihr Team, dass Fat Mike und auch die anderen auftretenden "Punkrock Dads" dermaßen offen sind und auch die Momente im Leben zeigen, die eben alles andere sind als das Klischee, das sie in der Musikerrolle spielen müssen. Fat Mike ist einer der zwei Hauptprotagonisten, die Nevins besonders nah ran ließen. Die Ironie, die auch sein Songwriting auszeichnet, blitzt immer wieder auf, wenn er über sein Familienleben spricht. Einmal fährt er sich im Interview mit der Hand über das große Tattoo auf seinem Oberarm, blickt darauf und sagt: "Tja, die zwei Comic-Dominas, die ich hier auf meiner Haut habe, eine mit einem Ballgag im Mund, die andere fest verschnürt: Wir erkläre ich das mal meiner Tochter?"
Man tut dem Film jedoch Unrecht, wenn man ihn nur auf die amüsanten Szenen reduziert, die nun mal entstehen, wenn ein junger, nihilistischer Musiker, der das System ficken will, plötzlich Teil dieses Systems wird, damit seine Familie gut leben kann. Oder wie Brett Gurewitz, Gitarrist bei Bad Religion und Gründer des Labels Epitaph, einmal so schön sagt: "Du weißt ja wie das ist. Du bist 18, schreibst einen Song namens, 'Fuck the world, I’m gonna die before I get old' – und dann wirst du alt. Und willst nicht sterben."
Für die ernsteren Tönen ist vor allem Jim Lindberg zuständig, dessen Entwicklung den roten Faden von The Other F Word liefert, um den die anderen Interviews arrangiert werden. Lindberg ist der Sänger der ebenfalls kalifornischen Punkband Pennywise, die er 1988 gründete. Ähnlich wie NOFX touren Pennywise noch immer durch die ganze Welt, ihre Songs wie "Fuck Authority", "Revolution" oder "Victim Of Reality" sind Genre-Klassiker des melodischen, politischen Punkrocks. Der Booker von Pennywise sagt im Film: "Früher warst du als Band einmal im Jahr länger auf Tour und sonst zuhause. Heute ist es andersrum." Lindberg gewährt im Film immer wieder Einblicke in das Leben zwischen den Shows, das bei einer Band wie Pennywise eben oft in Easy-Jet-Fliegern und tristen Drei-Sterne-Hotels stattfindet. Am Anfang von The Other F Word packt er gerade die Taschen für eine weitere Reise, und seine Töchter wollen ihm ein paar Barbie-Puppen mitgeben, damit er nicht so alleine ist. "Die könnten aber im Tourbus in Schwierigkeiten geraten", scherzt er noch – und sagt dann kurz darauf, als die Kinder aus dem Zimmer sind: "Meine Tochter sagte einmal zu mir: 'Ich hasse es, wenn du los musst. Ich mag das wirklich nicht.' So was bricht dir das Herz." Lindberg zog während den Dreharbeiten auch die Konsequenzen aus diesen Empfindungen – und verließ die Band für einige Jahre, um mehr Zeit mit seiner Familie verbringen zu können.
"Es gibt schon diese Momente, wenn ich zum Beispiel bei einem Elternabend sitze und mich frage: Scheiße, musste ich mir wirklich die Stirn tätowieren lassen? Aber das geht schnell wieder vorbei: Ich möchte meinem Sohn beibringen, dass er die Menschen nach ihrem Handeln beurteilt und nicht nach ihrem Aussehen."
Lars Frederiksen (Rancid)
Was diesen Film so rührend und auch so wichtig macht, ist die Art, wie man bei all der Situationskomik im Grunde vor allem sieht, wie diese Männer versuchen, bessere Väter zu sein, als es ihre eigenen waren. Und das in einer immer noch von Männern dominierten Welt wie Punkrock, wo es gilt, hart und aufmüpfig zu sein. Mark Hoppus von Blink-182 sagt dazu: "Das einzig Gute, an dem was ich beruflich mache, ist: Die Erwartungen an mich als Vater sind so verdammt niedrig. Die Leute denken, nur weil ich in dieser Band spiele, bin ich wahrscheinlich immer der besoffen durch die Gegend taumelnde Typ, der noch zur Einschulung seiner Kids mit einer Flasche in der Hand und einer Prostituierten im Arm aufläuft."
Die Szenen, in denen Charaktere wie Flea von den Red Hot Chili Peppers, Tony Cadena von The Adolescents, Duane Peters von den U.S. Bombs und vor allem Art Alexakis von Everclear über ihre abwesenden, gewalttätigen, süchtigen Väter sprechen, treiben dann selbst hart gesottenen Punkrockern die Tränen in die Augen.
Auch hier muss man wieder einmal den Hut ziehen vor Andrea Blaugrund Nevins, dass sie ihre Interviewpartner an diese Punkte gebracht hat. Dank ihr ist diese Dokumentation, die bei anderen, weniger sensiblen Regisseuren schnell zum anekdotenhaften Klamauk hätte werden können, ein im Kern feministisches, intimes Portrait über Männer geworden, die versuchen, diese neue, wichtige Rolle anzunehmen, die ihre eigenen Väter verkackt haben. Und das oft erstaunlich gut hinbekommen – eben weil sie ihre vermeintliche Härte manchmal abschütteln.
P.S.: Und hier noch der sehr gute kompilierte Soundtrack…
DK
DK