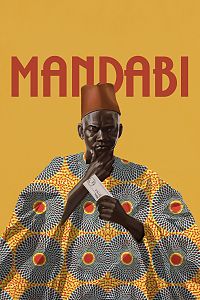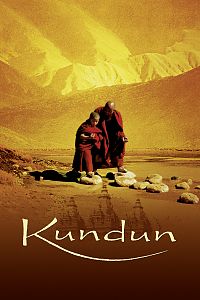Mandabi: Geld ist nicht alles
Nicht nur Martin Scorsese gehört zu den großen Bewunderern Ousmane Sembènes, der als Vater des afrikanischen Kinos gilt. Sein in Wolof gedrehter tragikomischer Spielfilm Mandabi aus dem Jahr 1968 liegt nun in 4K-restaurierter Fassung vor!
1968 war nicht nur in Europa und in den USA ein einschneidendes Jahr, damals kam es auch im Senegal zu Studenten- und Arbeiter*innenprotesten. Das westafrikanische Land war noch kein Jahrzehnt lang unabhängig, und so liefen kritische Künstler*innen dort nicht nur Gefahr, als staatszersetzende Elemente gebrandmarkt zu werden, wie dies etwa in der Bundesrepublik der Fall war. Nein, man stempelte sie gleich als Feinde der Unabhängigkeit und des Prozesses der Nationenbildung ab. Ein harter Vorwurf. Da wurde auch für den Schriftsteller und Filmemacher Ousmane Sembène keine Ausnahme gemacht, der im besagten "revolutionären" Jahr tatsächlich einen geradezu revolutionären Film schuf, auf den man im Senegal durchaus mit einigem Stolz hätte blicken können (und es heute auch tut). Im lesenswerten Booklet zur neuen 4K-restaurierten Edition heißt es: "Mandabi war der Höhepunkt einer Dekade des Filmemachens, in der Sembène zahlreiche Formen des Realismus entdeckte, um den Albtraum der Ungerechtigkeiten des Kolonialismus in einer Gesellschaft einzufangen." Zudem war Mandabi der erste in subsaharisch-afrikanischer Sprache gedrehte Spielfilm überhaupt. Dass die Charaktere Wolof statt Französisch sprachen, brachte sie dem Publikum natürlich näher. Trotzdem hieß es nach der Veröffentlichung, der Film sei unpatriotisch. Eine Art Sabotage des bestehenden Einparteienstaats. Dabei deckt Mandabi die Fallstricke einer von Jahrzehnten der Fremdbestimmung geprägten Gesellschaft auf, in der alte Verhaltensmuster überdauerten und in der sich bereits neue Probleme am Horizont abzeichneten. Doch in der herrschenden Quasi-Diktatur waren solche Wahrheiten nicht gerngesehen, nicht mal in einem richtig guten Kunstwerk. Das gilt außerdem für weitere Filme und Bücher Sembènis, wie das von ihm verfasste und ebenfalls verfilmte Xala.
Ibrahima Dieng kann sich nicht viel leisten © Studiocanal
Auch Mandabi basiert auf einem Roman von Ousmane Sembène und erzählt eine tragikomische Geschichte. Im Mittelpunkt der Handlung steht die titelgebende Zahlungsanweisung, die Ibrahima Dieng (Makhouredia Gueye) aus Paris erreicht. Sein Neffe arbeitet dort als Straßenkehrer – er hat sich also den Traum vom Leben in einer europäischen Großstadt erfüllt. Die utopischen Züge, die jene migrantische Existenz in der Vorstellung der im Senegal in ärmlichen Verhältnissen lebenden Verwandten und Bekannten annimmt, konterkariert Sembène mit lakonisch-realistischen Bildern aus Paris, in denen zumindest der Ansatz des Traumes noch erkennbar ist, der den jungen Mann dorthin brachte. Lustig machen will Sembène sich über seine Figuren nicht, auch wenn es ab und an was zu lachen gibt. Ibrahima und Co bleiben diese Bilder sowieso verborgen. Alle sehen nur das Geld, das die Post aus der Diaspora verspricht. Zwei Frauen, sieben Kinder – insofern kommt die Nachricht des Neffen gerade recht, Ibrahima könne einen Teil des Geldes behalten, er müsse die Zahlungsanweisung nur bitte einlösen. Hinter der leichten Hysterie in Aussicht auf frisches Bargeld, die im Kreis der Arbeitslosen in den Slums von Dakar rund um Ibrahima und seine Frauen sofort auszumachen ist, steckt die harte materialistische Kritik Ousmane Sembènes an der jungen postkolonialistischen Gesellschaft des unabhängigen Senegal. Kritik an einem System, das mit dem Erbe des Kapitalismus auch das Erbe der sozialen Ungerechtigkeiten, der depressiven Zustände und der alttäglichen Gaunereien angetreten ist. Nicht zuletzt wird das Patriarchat aufs Korn genommen, wenn auch am zaghaftesten. Ibrahima jedenfalls gerät schnell zur Zielscheibe für Betteleien und Betrugsversuche seiner Nachbarn. Da hat er das Geld noch nicht mal abgeholt.
Im senegalesischen Neorealismus des Ousmane Sembène liegt die Wahrscheinlichkeit eines Happy Ends auf demselben Niveau wie die Möglichkeit einer wahrhaft kommunistisch organisierten Gesellschaft
Ausgerechnet die vermeintlich einfache Angelegenheit entpuppt sich dann noch als die schwierigste Sache überhaupt. Auf dem Weg zur Bank und wieder zurück verläuft sich Ibrahima, der im Gegensatz zu seinen Frauen nicht mal lesen kann, auf Grund seiner familiären und gesellschaftlichen Stellung aber wie selbstverständlich den Behördengang erledigt, im Dschungel der Bürokratie. Immer wieder bieten ihm Leute ihre Hilfe an – nicht ohne Gegenleistung natürlich. In seiner Verzweiflung wendet sich Ibrahima an die Falschen und steht letztlich vielleicht sogar mit leeren Händen dar.
Warten auf bessere Zeiten © Studiocanal
Das Filmende soll nicht verraten werden, aber im senegalesischen Neorealismus des Ousmane Sembène liegt die Wahrscheinlichkeit eines Happy Ends auf demselben Niveau wie die Möglichkeit einer wahrhaft kommunistisch organisierten Gesellschaft, in der jeder nach seinen Fähigkeiten tätig und nach seinen Bedürfnissen versorgt ist. Ein Traum immerhin, den manche bis heute träumen. 1968 war er groß in Mode. Das macht Mandabi auch zu einem Zeugnis der globalen Protestbewegungen, die einst für ein andere, bessere Welt kämpften.
Ousmane Sembène (1923 – 2007) © Kino Lorber
WF