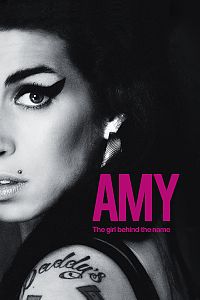Moulin Rouge: Heißer Tanz und prächtige Farben
John Huston porträtierte in seinem Klassiker vor 70 Jahren den Maler Henri de Toulouse-Lautrec und schuf ein Sittengemälde der Pariser Gesellschaft der Jahrhundertwende.
Menschen, die Kunstwerke von Henri de Toulouse-Lautrec bewundern, finden dessen Gemälde womöglich so beeindruckend, weil dem Maler selbst die eigenen Motive nie aus dem Kopf gingen. In John Hustons Biopic Moulin Rouge von 1952 – benannt nach jenem legendären Etablissement, in dem Toulouse-Lautrec vornehmlich verkehrte und dessen Außenwahrnehmung er durch eigens gestaltete Plakate entscheidend prägte – verfolgen ihn diese Motive gar bis auf Sterbebett. Wie in besten Tagen spuken sie in seinem Kopf herum, und während der Sensenmann sein Werkzeug bedrohlich schwingt, schwingen die Tänzer*innen ihre Beine im Takt, wettstreiten untereinander und feiern doch das Leben gemeinsam. Toulouse-Lautrec scheint in diesem Augenblick des nahen Todes gewiss, dass er seine Zeit auf Erden nicht verschwendet hat, auch wenn ihm mitunter (so von der Mama) nahegelegt wurde, sich aus dem ordinären Pariser Nachtleben zu verabschieden und seinen Leinwänden impressionistischere Bilder anzugedeihen, die einem etwas gesitteteren Lebenswandel entsprächen. Nur einen van Gogh, den wollte und konnte Toulouse-Lautrec nicht imitieren, obwohl er ihn verehrte. Der aus bestem Hause stammende Henri hatte seine Bestimmung in der Gosse gefunden, auch wenn sie ihn selten glücklich machte.
Toulouse-Lautrec mit Jane Avril © Studiocanal
Das Schicksal hatte es früh nicht unbedingt gut mit ihm gemeint. Bedingt durch eine Erbkrankheit und diverse Stürze, stoppte beim jugendlichen Henri de Toulouse-Lautrec das körperliche Wachstum. Im Film purzelt er die Treppe herunter und bricht sich die Beine unheilbar. Womöglich liegt darin einer der Gründe, warum er als Künstler über sich hinauswachsen konnte, schließlich bekennt er in Moulin Rouge an einer Stelle, dass er vielmehr er selbst sei, wenn er zeichne und male, als wenn er es nicht tue und eben bloß als der kleinwüchsige Mann mit den verkrüppelten Beinen erscheine. Und doch macht den großen Künstler eben diese körperliche Versehrtheit aus, sie speist seinen Selbsthass und die Sehnsucht nach einem makellosen Antlitz, das die Frauen betört. Hinzu kommt die Abhängigkeit vom Alkohol, eine Zügel- und Maßlosigkeit, die ihn das Treiben im Paris der vorletzten Jahrhundertwende an der Staffelei in die heute von ihm bekannte Farbenpracht verwandeln ließ. An diesen Farben orientierte sich auch Regisseur Huston, dem selbst als Kind eine schwächliche Konstitution bescheinigt wurde, bevor er das Schicksal in die Hand nahm, mit dem Boxen begann und die Untiefen der Existenz schließlich als Künstler auslotete – samt platt gehauener Nase. Weshalb er psychologisch womöglich sehr viel mit der gebrochenen Figur des Malers anzufangen wusste.
Marie und Toulouse-Lautrec © Studiocanal
Der von José Ferrer gespielte Henri de Toulouse-Lautrec ringt nach Leibeskräften und unter Aufwendung all seiner Leidenschaften mit dem Leben, bezeugt dem Amüsierbetrieb und dessen Protagonist*innen seine Hingabe – so neckt er gern die miteinander im Dauerclinch liegenden Hauptattraktionen der Tanzfläche des Moulin Rouge, La Goulue und Aicha. Auch hat er stets ein offenes Ohr für die neuesten Liebesabenteuer der von Zsa Zsa Gabor verkörperten Jane Avril und kurbelt mit seiner Trunksucht allabendlich den Umsatz an. Huston konzentriert sich in seiner Verfilmung von Toulouse-Lautrecs Vita nach einer Novelle von Pierre La Mur auf die unmögliche Liebe des Malers zu Marie Charlet, die aus ärmlichen Verhältnissen stammt und ihn immer dann vor den Kopf stößt, wenn er selbst mal nicht zu tun geneigt ist. Das kann nicht gutgehen, ahnt man schnell. Um diese toxische Beziehung herum entwirft Huston noch dazu ein bewegtes Sittengemälde nach Art der Pinselstriche seines malenden Helden, worin die markanten Umrisse einer Gesellschaft der Unterschiede deutlich werden. Einer Welt, in der neben den sichtbaren Bildern die unsichtbaren eine gleichberechtigte Rolle spielen – so genannte Ideale und jene falschen Vorstellungen, die so viele sich vom Leben und der Kunst machen.
Zsa Zsa Gabor tanzt © Studiocanal
Henri Toulouse-Lautrec ist es vergönnt, sich nach der amourösen Katastrophe mit Marie ein zweites Mal zu verlieben – in Myriamme. Doch ob John Huston ihm ein Happy End zugesteht? Siehe oben, oder besser noch: Sehen Sie selbst! Denn wie bei der Untersuchung eines Gemäldes liegt die wahre Geschichte auch hier im Auge des Betrachters. Die hätte wiederum kein anderer Maler als Henri de Toulouse-Lautrec so malen – und kein anderer Regisseur als John Huston hätte die Geschichte so verfilmen können. Ganz nebenbei thematisiert Huston auch einen gewissen "Verfall" des Moulin Rouge, da es es sich nach Toulouse-Lautrecs künstlerisch wertvollen Werbemaßnahmen zu einem allzu anständigen Haus wandelt. Die Zügellosigkeit eines ausschweifenden Lebens und das Auskosten der eigenen Tragik schmeichelt womöglich nicht der physischen Erscheinung, der Kunst jedoch tun sie keinen Abbruch. Darin sind Toulouse-Lautrec und Huston sich einig.
WF