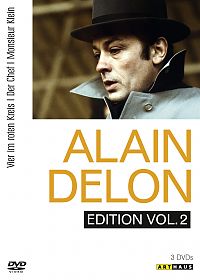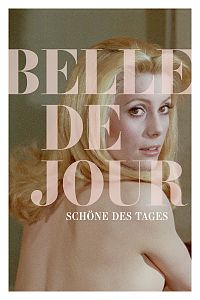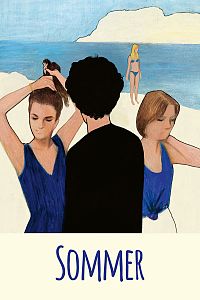Die Ballade vom eisigen Bullen : Der Chef – Un Flic
Jean-Pierre Melvilles letzter Film ist eine kalte, beeindruckend gefilmte Gangsterballade mit Alain Delon, Richard Crenna und Catherine Deneuve.
Es ist eine schöne Pointe, dass Alain Delon in Jean-Pierre Melvilles letztem Film mal nicht auf der Seite der Gangster steht, sondern den melancholischen Polizisten Edouard Coleman spielt. Zumindest will man anfangs glauben, dass es Melancholie ist, die diesem schönen Mann am Halse hängt. Obwohl schon das Zitat vor dem Film in eine andere Richtung weist. Da heißt es, zitiert nach Eugène François Vidocq: "Die einzigen Gefühle, die ein Mensch jemals bei einem Polizisten hervorzurufen vermag, sind Mehrdeutigkeit und Zynismus." Der 1775 geborene Vidocq kannte sich mit beidem aus: Er war zunächst gefürchteter und verurteilter Krimineller, wechselte später die Seiten und wurde ein Visionär der Kriminalistik. Sein poetisches "ACAB", das Coleman später noch mal vor einem Kollegen zitiert, ist so etwas wie die These, die Melville mit seinem Film bebildern will.
Denn in Der Chef – Un Flic gibt es kein Gut und Böse. Jeder ist in seiner Rolle im Grenzgebiet zwischen Gesetz und Verbrechen gefangen. Und verliert dabei schon mal den Antrieb, die Moral oder das Vertrauen in das Gute im Menschen.
Der Film beginnt mit einem brutalen Bankraub im französischen Küstenort Saint-Jean-de-Monts kurz vor Weihnachten, ausgeführt vom Pariser Nachtclub-Besitzer Simon und seinen Komplizen. Simon ist der Kopf der Bande, ein klar denkender, kalt abwägender Berufskrimineller, der in Raub und Drogenschmuggel verstrickt ist und seinen Nachtclub eher als Fassade und Treffpunkt betreibt. Edouard Coleman kennt und schätzt ihn schon lange – auch wenn er anfangs nicht weiß, dass bei Simon die Fäden seiner zwei aktuellen Fälle zusammenlaufen. Die beiden lieben außerdem die schöne Cathy (Catherine Deneuve) – mit dem Wissen des jeweiligen anderen, wie sich herausstellt. Auch Cathy kann, wenn sie es muss und will, den eiskalten Engel geben: Ohne Skrupel bringt sie im Krankenhaus den beim Bankraub angeschossenen Komplizen von Simon um. Aus der Dreiecksbeziehung von Simon, Cathy und Coleman speist sich die Tragik der Geschichte – was Melville, der auch das Drehbuch schreibt – schnell deutlich macht. Man weiß schon nach wenigen Filmminuten, dass die Drei am Ende aufeinandertreffen und nicht alle überleben werden.
Simon und seine Komplizen © Kinowelt GmbH
Es ist aber nicht die Handlung, die diesen Film sehenswert macht. Eher im Gegenteil: Man hat bisweilen das Gefühl, dass Melville manchmal nicht so recht wusste, wo er mit der Story hinwill. Oder vielmehr: Er merkte, dass die Kraft des Films vielleicht eben nicht in der Geschichte liegt, sondern in der Stimmung, die er von Anfang an setzt. Melville nimmt sich viel Zeit für die ruhigen Minuten vor dem Bankraub, in dem man nur Regen, Rauchen und schweigende Männer im Mantel sieht. Er weidet sich an der traurigen Schönheit des winterlichen Paris. Er schickt seine wortkargen Protagonisten in graubraunen Mänteln und Hüten in die Welt, wo sie wie Momos graue Herren ihre Agenda verfolgen. Er nimmt die Architektur ins Bild um Kälte zu erzeugen – zum Beispiel im Saint-Jean-de-Monts – ein Sommertraum, der hier von Regen und Sturm gepeitscht wird, bis er trist und tot wirkt.
Es ist diese Kälte, die nach und nach auch den Protagonisten in die Seele kriecht. Während man sich wie immer in Alain Delon verliebt und sich gerade mal freut, dass er nicht den Killer mit Charme gibt, zeigt Melville nach und nach, wie clever, kalkuliert und böse Coleman sein kann. Erst sind es einzelne Szenen: Backpfeifen, die er ohne mit der Wimper zu zucken verpasst oder Ansagen an seinen Kollegen, die Widerspruch gar nicht erst einplanen – was ihn wiederum mit Simon verbindet. Später werden es dann: böse, eigennützige Taten.
Es gibt sicher zugänglichere Filme von Melville, aber Der Chef – Un Flic ist gerade deshalb so einzigartig, weil er auch mal auf der Stelle tritt, die Monotonie der ewigen Spirale aus Verbrechen und Strafe zeigt – und bei all dem stilistisch immer wieder ins Schwarze trifft. Oder in diesem Fall: ins Graue.
DK