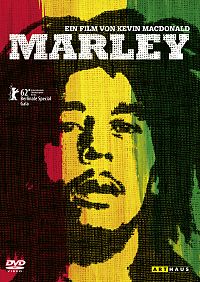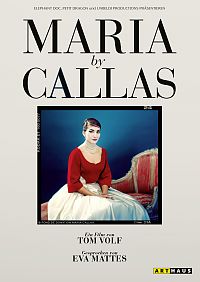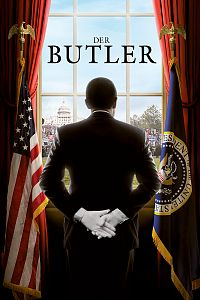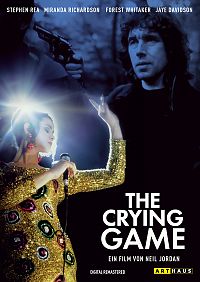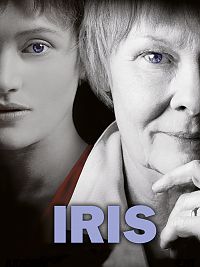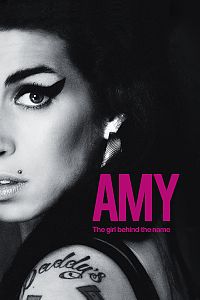Zum Start von Like A Complete Unknown: Fluch und Segen der Biopics
In dieser Woche startet das neue Biopic über Bob Dylan in den deutschen Kinos: James Mangolds Like A Complete Unknown mit Timothée Chalamet wirft bei uns die Frage auf, wie man eigentlich zum sehr berechenbaren Genre des Biopics steht. Dazu schauen wir auf Filme wie Back To Black, Control, Love & Mercy oder Serge Gainsbourg – Der Mann, der die Frauen liebte.
Die Oscar-Nominierungen sprechen eine klare Sprache: Like A Complete Unknown von James Mangold ist in sage und schreibe acht Kategorien nominiert – darunter auch die Königsdisziplinen "Best Film" und "Best Actor" für Timothée Chalamet. Als Chalamet kürzlich für die Berlinale zur Deutschlandpremiere anreiste, gab es Euphorie am Roten Teppich und dutzende hippe Influencer:innen, die auf TikTok, Twitch und Insta von diesem Film und ihrem Star schwärmten. Die Kritiken sind und waren freundlich bis begeistert: Chalamet lebt diese Rolle, die Ausstattung stimmt, die Musik im Film funktioniert und selbst die gerne die Nase rümpfenden Dylan-Fans geben ihr Approval. Bei "Rotten Tomates" hat der Film ein Audience Rating von satten 95 Prozent. Auch die ersten Zahlen aus all den Ländern, in denen der Film schon seit Dezember läuft, sind mehr als positiv: Like A Complete Unknown zählt schon jetzt zu den erfolgreichsten Musik-Biopics aller Zeiten. Die vorher ziemlich waghalsig wirkende Rechnung, Bob Dylan bei einem jungen Publikum wieder cool zu machen, ging also auf. Man wundert sich heute schon gar nicht mehr, dass die Jeansmarke Levi’s "zu Ehren von Bob Dylan" eine Vintage-Kollektion feilbietet: Das Hosenmodel, das Chalamet im Film trägt, gibt’s für schlanke 550 Euro, die Wildlederjacke für 1150 Euro.
Malen nach Zahlen
Alles gut also. Oder? Ach. Was man in einigen Kritiken liest, die dem Hype nicht ganz auf dem Leim gehen wollen, treibt auch uns um: Die Dramaturgie von Like A Complete Unknown ist mal wieder wie Malen nach Zahlen – was bei mindestens drei Vierteln aller Biopics der Fall ist. Immerhin hat sich Regisseur James Mangold erlaubt, Chalamet als enigmatischen Dylan zu inszenieren und beide tun nicht so, als hätten sie ihn völlig geblickt. Außerdem scheint es bei Biopics immer nur zwei Möglichkeiten zu geben: Entweder man quetscht ein ganzes Leben auf Filmlänge, oder aber man pickt eine besonders prägende Zeit – wie es bei Like A Complete Unknown der Fall ist, der sich überwiegend auf das Buch "Dylan Goes Electric" von Elijah Wald bezieht und die New-York-Zeit vor seinem Auftritt beim Newport Folk Festival am 25. Juli 1965 in den Mittelpunkt stellt.
Man sieht diese Filme ja gerne: Aber da die Original-Künstler:innen immer die Schauspieler:innen überstrahlen und man vieles, das man nun auf der Leinwand sieht, schon aus Dokumentationen, von Live-Alben und Fotos oder aus Musikmagazin-Storys kennt, kann man nie so ganz das Gefühl abschütteln, hier einem gut ausgestatteten Cosplay beizuwohnen. Auch Musikszenen in Biopics sind tricky, weil man die Leidenschaft, die Euphorie, die Unmittelbarkeit eines echten Live-Mitschnitts niemals toppen kann. Trotzdem haben wir zum Beispiel Back To Black sehr gemocht, weil man schnell dem Charme von Marisa Abelas Amy Winehouse erliegt. Auch Bob Marley: One Love mit Kingsley Ben-Adir hat seine Momente – selbst, wenn wir nicht leugnen können, dass uns die Dokumentation Amy und Marley mehr bewegt haben.
Kreative Wagnisse sind schwierig – wenn die Erben und Labels im Boot sind
Biopics sind immer dann am besten, wenn sie sich mehr trauen – was natürlich leichter gesagt als getan ist. Immerhin hängen ja meistens die Plattenfirmen und Erb:innen mit drin. Und die haben nun mal ein Interesse daran, dass ihre Künstler:innen besonders positiv inszeniert werden. Hier lohnt es sich, auf das Beispiel Elvis Presley zu schauen. Baz Luhrmann durfte mit offiziellem Segen und einem Riesenbudget ganz Baz Luhrmann sein und ein Baz-Luhrmann’eskes Elvis-Musical inszenieren, das dank Austin Butler und atemraubenden, wunderschönen Sequenzen durchaus sehenswert ist. Dem echten, oft problematischen Elvis kommt man aber durch Sofia Coppolas Priscilla näher, in dem nicht ein einziger Elvis-Song zu hören ist, weil Coppola die Rechte nicht bekam. Aber bei ihr sieht man Elvis eben nicht (nur) als charismatischen King of Rock’n‘Roll, sondern auch als weirden, Teenager-groomenden Kontroll-Freak, der Elvis auch war.
Eine gute Balance aus Verehrung und kreativem Eigensinn findet Bill Pohlads Love & Mercy über Brian Wilson und The Beach Boys – mit Paul Dano und John Cusack als junger und älterer Wilson. Gleiches gilt für Joan Sfars Gainsbourg – Der Mann, der die Frauen liebte. Sfar setzt auf surreale Elemente und einen bissigen Humor, der einerseits die Faszination für Gainsbourg verstärkt, andererseits aber auch problematische Kapitel und Verhaltensweisen zeigt.
Eine Frage der Ästhetik
Das Joy Division- bzw. Ian Curtis-Biopic Control wiederum funktioniert vor allem, weil Regisseur und Musikfotograf Anton Corbijn die Ästhetik dieser bis heute prägenden Band in das Medium Film überführen konnte – und diese dramatische Geschichte sehr behutsam erzählt. Was auch daran liegt, dass Control auf dem Memoire "Touching From A Distance" von Curtis‘ Ehefrau Deborah beruht, die einen sehr privaten, verletzten und zugleich emphatischen Blick auf diesen ebenso genialen wie gequälten Mann ermöglicht. Das farbenfrohe Kontrastprogramm dazu ist dann sicherlich Oliver Stones geliebter wie gehasster Film The Doors, der die psychedelischen Noten ihrer Musik und ihrer Karriere mit grellen Farben auf die Leinwand wirft und Val Kilmer dermaßen von der Leine lässt, dass dieser manchmal schon fast "over the top" wirkt. Was man bei einem Larger-Than-Life-Typen wie Jim Morrisson ja erst einmal hinbekommen muss.
Der Reiz von erfundenen Biografien
Als Filme schauende Musikfans und Musik liebende Filmfans fällt uns allerdings immer wieder auf, dass die besten "Biopics" oft die sind, die einfach eigene Künstler:innen erfinden – oder reale Vorbilder lediglich zitieren. Der bessere Film über das New York, in dem Bob Dylan zum enigmatischen Star wurde, ist zum Beispiel Inside Llewyn Davis von den Coen-Brüdern, die hier die Biografie von Dave Van Ronk lediglich als erste Inspiration nahmen. Auch Whiplash von Damien Chazelle über den fiktiven Drummer Andrew (Miles Teller) und seinem toxischen Lehrer Terence Fletcher (J. K. Simmons) lehrt uns mehr über Jazz und Ehrgeiz, als das jedes Biopic könnte. Und ist es nicht völlig scheißegal, dass es die irische Teenage-Band Sing Street niemals gegeben hat? Wobei das dann auch nicht so ganz stimmt: Die originalen, extra für den Film geschriebenen Lieder aus dem Film von John Carney wurden später regulär unter dem Namen Sing Street veröffentlicht.
Wie auch immer man zu Biopics steht: Es wird sie weiterhin geben. Die guten und die schlechten. Aber wenn man abseits von Like A Complete Unknown schaut, muss man feststellen, dass viele Regisseur:innen das Problem der berechenbaren Dramaturgie inzwischen erkannt haben. Pablo Larraín nimmt sich zum Beispiel im aktuellen Maria viele Freiheiten, blickt auf eine Black-Box in der Biografie der großen Maria Callas und spielt mit surrealen Elementen. Better Man – Die Robbie Williams Story wiederum ist ein einziges kreatives Wagnis und damit eines der aufregendsten Biopics der letzten zehn Jahre. Es bleibt also doch irgendwie spannend – in einem Genre, das per Definition Spannung nur selten auf der Bingo-Karte hat.
Lass dich von unseren Top 15 Musikfilmen auf Letterboxed inspirieren!
Daniel Koch