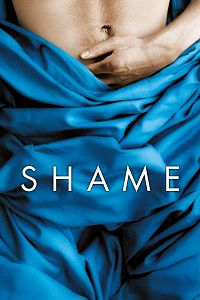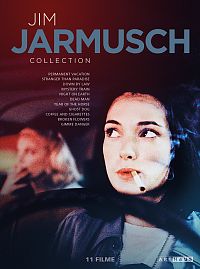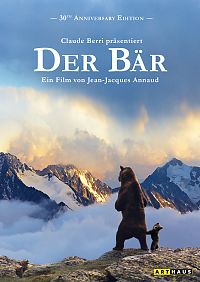Zum 100. von Sam Peckinpah: Mit dem Convoy ins Blutbad
Der amerikanische Regisseur Sam Peckinpah, der in dieser Woche 100 geworden wäre, wurde nicht umsonst "Bloody Sam" genannt. Filme wie Steiner – Das Eiserne Kreuz (Foto), The Wild Bunch – Sie kannten kein Gesetz und Bring mir den Kopf von Alfredo Garcia zeigten blutgetränkt, zu was der Mensch fähig ist. Sein vergleichsweiser zahmer Film Convoy gilt heute als Kultfilm und prägte die Kindheit unseres Autors.
Mit zwölf wollte ich "Rubber Duck" sein. Der bärtige, sonnenbebrillte, stoische Trucker, der nach einem Highway-Flirt (den man heute zum Glück nicht mehr so erzählen würde) in einen Konflikt mit dem korrupten Sheriff Wallace gerät und diesen bis zu einem Aufstand der LKW-Fahrer eskalieren lässt. Convoy war mein erster bewusster Kontakt mit dem Regisseur Sam Peckinpah. Wobei mir das Konzept "Regisseur" damals nicht so wirklich bewusst war. Erst mit 13, nachdem sicherlich 27. Mal Convoy schauen, hatte ich so langsam eine Ahnung, dass dieser Beruf die Filme, die ich liebte, formt.
Als ich das einmal begriffen hatte, studierte ich die Fernsehzeitung ganz anders. Ja, in den 90ern machte man das noch so. Vor allem das Nachtprogramm hatte es mir angetan und brachte mich ein paar Jahre zu früh mit Filmen in Kontakt, die ich eigentlich nicht sehen durfte – und damit ist nicht nur die Emanuelle-Reihe gemeint. Zum Glück hatte ich schon mit 13 einen eigenen Fernseher auf dem Zimmer und konnte heimlich schauen.
Sam Peckinpah – dieser Name, dessen Klang sich geradezu in den Kopf hämmert, wenn man ihn laut ausspricht – war glaube ich einer der ersten Regisseure, die ich mir merkte. Angefixt von Convoy – der mich sogar dazu brachte, Modelltrucks zu bauen – schaute ich fortan nach Filmen von ihm und wurde irgendwann fündig. Ich weiß nicht mehr, in welcher Reihenfolge es passierte, aber so sah ich mit 13 oder 14 The Wild Bunch, Steiner – Das Eiserne Kreuz, Straw Dogs (mit seiner im Grunde unverzeihlichen Vergewaltigungsszene) und einmal – auf der VHS eines Freundes – Bring mir den Kopf von Alfredo Garcia.
Ich war schockiert. Und schuldbewusst begeistert. Gewalt hatte in dem Alter eh schon eine große Faszination auf mich – ich hörte harten Metal mit brutalen Texten und schlug auf meinem C64 fast täglich beim Game "Barbarian" mit langen Schwertern Barbaren-Köpfe ab. Aber Peckinpahs Filme wirkten intensiver. Die Gewalt war keine Show. Kein Spiel. Kein Spektakel. Sie war hart. Kalt. Real. Furchteinflößend. Und Peckinpah zwang mich, hinzuschauen. Er nutze Slow-Motion, wenn es eklig wurde. Er ging so nah ran, dass man fast glaubte, das Blut spritze gleich auf die Kamera, oder das Objektiv tauche direkt in eine große Wunde.
Sam Peckinpah, der am 28. Dezember 1984 im Alter von nur 59 Jahren verstarb, war ein verehrter und zurecht auch viel kritisierter Regisseur. Man nannte ihn damals nicht umsonst "Bloody Sam" und zählte ihn zu den Mitbegründern des Spätwesterns. Noch heute wirken Filme wie The Wild Bunch oder Pat Garrett jagt Billy the Kid nach. Man findet sie als Bezugspunkte in Kritiken zu Tarantinos The Hateful Eight ebenso wie im epischen Western-Videospiel "Red Dead Redemption 2".
Trotzdem gibt es in seinem reichen Oeuvre Hits and Misses und viele Cineasten halten selbst Convoy für einen seiner eher schwächeren Filme. Ebenso gibt es aber auch Filme, die seinem Ruf als Gewaltphilosoph entgegenstehen: Zum Beispiel das Fernsehdrama Noon Wine nach dem Roman von Katherine Ann Porter. Oder der leider im Kino gefloppte Junior Bonner, in dem Steve McQueen die Hauptrolle spielt. Ein nuanciertes, toll erzähltes Familiendrama, über das Peckinpah später zynisch sagte: "Ich habe endlich mal einen Film gemacht, in dem niemand erschossen wurde – und keiner wollte ihn sehen."
In einem Interview mit dem "Playboy" aus dem Jahr 1972 wurde ihm gleich zu Beginn die Frage gestellt: "Warum wollen Sie nicht über Gewalt reden?" Peckinpahs Antwort: "Weil es das ist, auf das mich alle festnageln wollen. Sie denken, ich hätte es erfunden. Sie denken, dass es mir nur darum geht. Sie denken, dass es mich erregt, wenn den Leuten auf meinen Bildern die Köpfe weggeblasen werden. Ich habe das verdammt noch mal satt."
Später im Gespräch redete Sam Peckinpah natürlich trotzdem drüber und sagte: "Man kann dem Publikum heute keine Gewalt mehr nahebringen, ohne es ihm unter die Nase zu reiben. Wir sind live bei unseren Kriegen dabei und sehen jeden Tag im Fernsehen Männer sterben. Sie sterben wirklich, aber es scheint nicht real zu sein. Wir glauben nicht, dass es echte Menschen sind, die da auf dem Bildschirm sterben. Wir sind von den Medien betäubt worden. Ich zeige den Menschen, wie es wirklich ist – und zwar nicht so sehr, wie es ist, sondern indem ich es zuspitze, es stilisiere. Die meisten Menschen wissen nicht einmal, wie ein Einschussloch in einem menschlichen Körper aussieht. Ich möchte, dass sie sehen, wie es aussieht. Das kann ich nur erreichen, indem ich nicht zulasse, dass sie das Bild beschönigen, als wären es die Sieben-Uhr-Nachrichten."
Bei diesem Zitat muss ich automatisch an meine erste Begegnung mit Steiner – Das Eiserne Kreuz denken, obwohl diese deutsch-amerikanische Produktion erst 1977 in die Kinos kam. Es ist leider der einzige Film von Peckinpah, den wir gerade im ARTHAUS-Roster haben. Ich schaute auch diesen Film als Teenager – zu einer Zeit, als ich gerade in der Schule den Holocaust auf dem Lehrplan hatte. Mich störte der Gedanke, sozusagen an der Seite von deutschen Wehrmachtssoldaten um die Krim zu kämpfen. Tatsächlich wird das Gedankengut der Nazis im Film wenig thematisiert. Kein Wunder, dass viele in Steiner – Das Eiserne Kreuz einen unkritischen Landser-Streifen sahen (hier gibt es einen sehr schlauen Text von Robert Lorenz darüber), der den Mythos der "sauberen Wehrmacht" befeuere.
Es sind Vorwürfe, die sich der Film gefallen lassen muss. Auch das Marketing spielte auf Breitenwirkung und mutet heute sensationsgeil und schief an. Ein Plakat setze zum Beispiel auf den Slogan: "Der größte und aufwendigste deutsche Film seit 1945." Der deutsche Trailer wiederum versprach wie ein im Wind wehender Persil-Schein für Wehrmachtssoldaten: "Der erste Film, der dem deutschen Soldaten zeigt, wie er wirklich war – gezwungen in einen erbarmungslosen Krieg, tat er seine Pflicht wie jeder andere Soldat der Welt."
Was mich aber damals traf und faszinierte: Bei allen berechtigten Vorwürfen, zeigt Steiner – Das Eiserne Kreuz, was Krieg wirklich bedeutet. Man sieht die allgegenwärtige, tägliche Gewalt, man sieht die brutale Logik, man sieht das Pendel aus Gewalt und Gegengewalt, man sieht, wer von Anfang an als Kanonenfutter gedacht war. Es sind Bilder und Szenen, die gerade in der heutigen Zeit noch einmal gesehen werden dürfen, wo die Kriege näherkommen und große Propagandamaschinen wieder daran arbeiten, die Gewalt unwirklich erscheinen zu lassen – oder sie ganz auszublenden.
Ich hadere bis heute mit Sam Peckinpah – weil er mir Dinge zeigte, von denen ich eigentlich dachte, ich wolle sie nicht sehen. Aber ich hadere auch mit ihm, weil er ein toxischer Regisseur war – einer, der Vergewaltigungsszenen drehte, die die Welt nicht brauchte und seine Crew und seinen Cast bisweilen mit testosteronbefeuerten Demütigungen "anspornte". Und trotzdem muss man diesem früh und tragisch verstorbenen Mann, der lange von Alkohol- und Drogensucht geplagt war, zugestehen, dass er das amerikanische Kino entschieden geprägt hat – und einem kleinen halbstarken Teenager zeigte, dass Gewalt, Geballer, Mord und Totschlag vielleicht doch nicht so cool sind, wenn man mal genau drauf schaut.
Daniel Koch